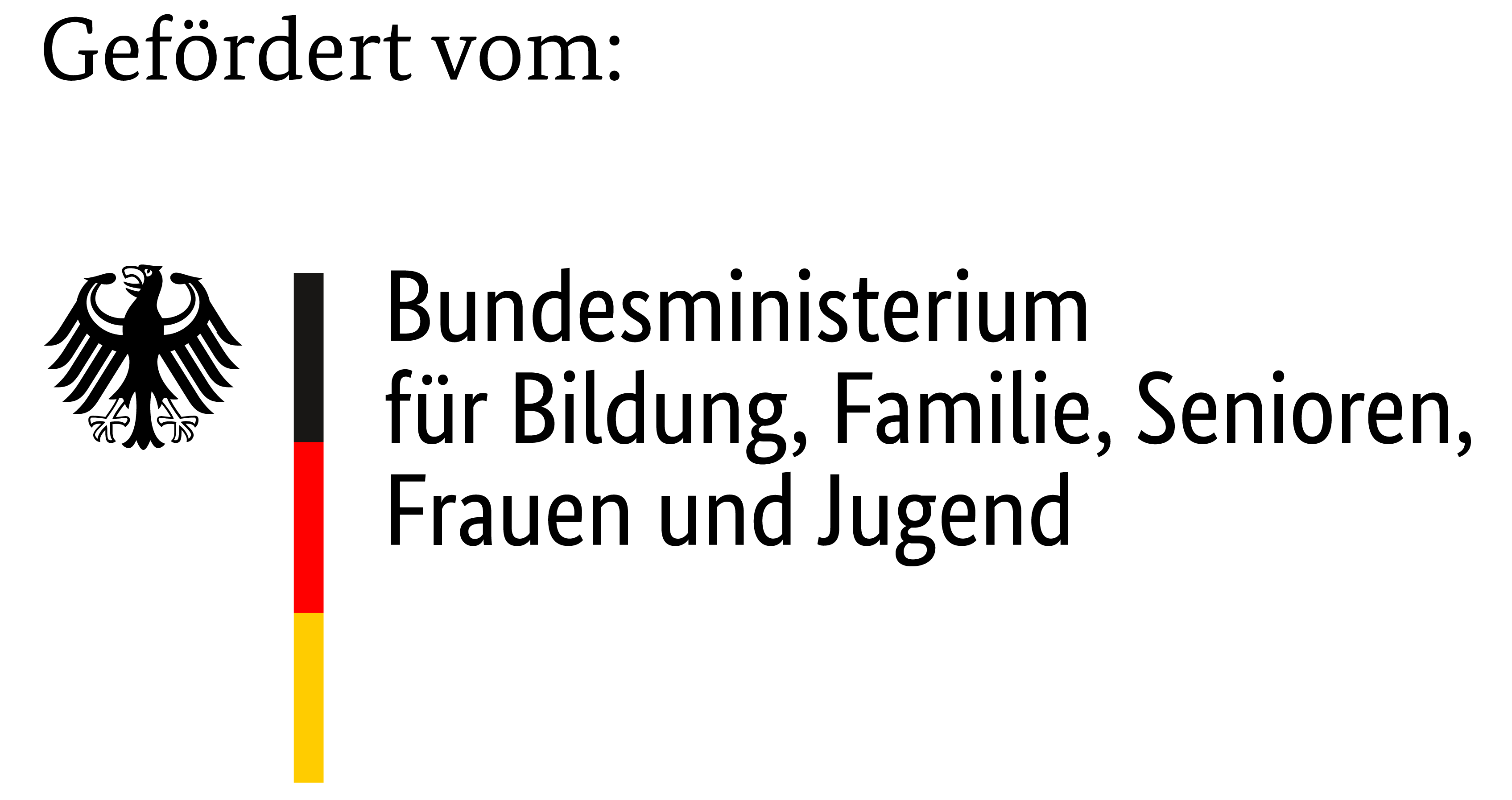Digitale Souveränität als Ziel fachdidaktischer Lehrkräftebildung in der digitalen Welt
Jörn Brüggemann & Volker Frederking
Ob Fake News oder Influencing, BigData oder KI – die digitale Transformation stellt schulisches Unterrichten vor neue Herausforderungen. Digitale Souveränität bietet sich vor diesem Hintergrund als neuer Orientierungsrahmen fachlichen Lehrens und Lernens an. Begründungszusammenhänge und Ansatzpunkte sollen nachfolgend erläutert werden.
Der Terminus ‚Digitale Souveränität‘ hat zunächst in politischen, wirtschaftlichen, technischen, gesellschaftlichen, juristischen, sozialwissenschaftlichen und medientheoretischen Diskursen Verbreitung gefunden (vgl. Friedrichsen & Bisa, 2016a, 2016b; Goldacker, 2017; Wittpahl, 2017; Rohleder, 2019; Ernst, 2020; Peuker, 2020; Wolff, 2022; Glasze, Odzuck & Staples, 2022). Definiert wird digitale Souveränität als „die Summe aller Fähigkeiten und Möglichkeiten von Individuen und Institutionen, ihre Rolle(n) in der digitalen Welt selbstständig, selbstbestimmt und sicher ausüben zu können“ (Goldacker, 2017, S. 3). Dabei gilt digitale Souveränität als Grundlage für die erfolgreiche Partizipation in und an der digitalen Weltgesellschaft (Friedrichsen & Bisa, 2016b, S. 1-6). Entscheidenden Anteil, dass sich der Begriff auch im Bildungsdiskurs etablieren konnte, hatte die im Auftrag des ‚Aktionsrates Bildung‘ verfasste Grundlagenschrift ‚Digitale Souveränität und Bildung‘ (Blossfeld, Bos, Daniel, Hannover, Köller, Lenzen, McElvany, Roßbach, Seidel, Tippelt & Woßmann, 2018; vgl. aber auch Koziol, Vogel & Steib, 2020; Müller & Kammerl, 2022). Digitale Souveränität wird hier „als übergreifendes Ziel digitaler Bildung“ (Blossfeld et al., S. 17) verstanden, als Möglichkeit, „digitale Medien selbstbestimmt und unter eigener Kontrolle zu nutzen und sich an die ständig wechselnden Anforderungen in einer digitalisierten Welt anzupassen“ (ebd., S. 12). Individuelle und gesellschaftliche Perspektiven werden dabei im Horizont der wegweisenden Unterscheidung zwischen technischen und ethisch-reflexiven Ausprägungen digitaler Souveränität verbunden (ebd., S. 18). Mit Blick auf die mit KI verbundenen neuen Herausforderungen skizziert Cordula Artelt (2023, S. 41) praktische Konsequenzen: „Eine mündige Auseinandersetzung mit KI-basierten Produkten, die darauf bezogene Argumentation, Beurteilung und das Hinterfragen der Lösungen sind wichtige Kompetenzen, die moderne Bildung ausmachen werden. […] Die Vermittlung digitaler Souveränität kann dabei nicht früh genug beginnen.“
Im fachdidaktischen Diskurs ist digitale Souveränität nach ersten deutschdidaktischen Konzeptualisierungen (Frederking, 2022) zuerst in zwei vom BMBF geförderten Forschungsverbünden systematischer theoretisch aufgearbeitet worden, um auf dieser Basis Fortbildungsmodule für Lehrkräfte zu entwickeln und empirisch zu untersuchen (Brüggemann & Frederking, 2024): „Digitale Souveränität als Ziel wegweisender Lehrer:innenbildung für Sprachen, Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften in der digitalen Welt (DiSo)“ und „Digital-ästhetische Souveränität von Lehrkräften als Basis kultureller, künstlerischer, musikalischer, poetischer und sportlicher Bildung in der digitalen Welt (DiäS)“. Beide Projekte knüpfen an die oben skizzierten erziehungswissenschaftlichen Ansätze an, verbinden diese aber mit genuin fachdidaktischen Perspektivierungen. Vier Aspekte sind hier zu nennen:
- Im Horizont fachdidaktischer Theoriebildung stellt digitale Souveränität ein zentrales Ziel fachlicher Bildung in der digitalen Welt dar (GFD, 2018; Frederking & Romeike, 2022). Sowohl Lehrkräfte als auch Schülerinnen und Schüler sollen zu einer selbstständigen, selbstbestimmten und sicheren Nutzung digitaler Medien in allgemeiner wie fachspezifischer Form befähigt werden. In den vom BMBF geförderten DiSo- und DiäS-Forschungsprojekten geschieht dies im Rahmen von Fortbildungsangeboten, die Lehrkräfte bei der Entwicklung bzw. Erweiterung digitaler Souveränität in fachspezifischer und fachübergreifender Weise unterstützen und in die Lage versetzen, ihre Schülerinnen und Schüler beim Aufbau bzw. bei der Vertiefung digitaler Souveränität in den sprachlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen bzw. ästhetischen Fächern zu unterstützen (Brüggemann & Frederking, 2024, S. 7ff.).
- Dabei umfasst digitale Souveränität aus fachdidaktischer Sicht nicht nur digitale Nutzungsfähigkeiten bzw. -kompetenzen, sondern auch eine selbst- und medienreflexive Haltung. In diesem Sinne ist es Ziel der DiSo- und DiäS-Fortbildungskonzepte, nicht nur digitale Nutzungskompetenzen von Lehrkräften zu vertiefen, sondern sie auch für Chancen und Risiken der digitalen Transformation zu sensibilisieren und sie zu befähigen, ihre Schülerinnen und Schüler zur Reflexion der Auswirkungen digitaler Medien auf das eigene Selbst- und Weltverhältnis aus allgemeiner und fachspezifischer Perspektive anzuregen (ebd., S. 9). Dies schließt ethische Fragen fachlicher Bildung in der digitalen Welt mit ein.
- Dem fachdidaktischen Modell digitaler Souveränität liegt die im Horizont Allgemeiner
Fachdidaktik (Bayrhuber, 2017; Frederking, 2017; Rothgangel, 2020) getroffene Unterscheidung
zwischen funktionalen und personalen Ausrichtungen fachlicher Bildung zugrunde (Frederking &
Bayrhuber, 2017; 2020). Funktionale fachliche Bildung umfasst die als Kompetenz-, Wissens- und
Leistungsdimensionen beschreibbaren Ziele von Fachunterricht - auf Basis kognitiver
Aktivierungen
im Sinne des COACTIV-Ansatzes (Baumert & Kunter, 2006; 2011). Personale fachliche Bildung
fokussiert den Aufbau selbst-reflexiver Haltungen im Horizont des eigenen Selbst- und
Weltverhältnisses - auf Basis subjektiver, emotionaler und kognitiv-selbstreflexiver
Aktivierungen
(Bayrhuber & Frederking, 2024).
In diesem Sinne zielt die Förderung digitaler Souveränität in den DiSo- und DiäS-Projekten darauf ab, Lehrkräfte der sprachlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ästhetischen Fächer darauf vorzubereiten, ihre Schülerinnen und Schüler in funktionaler fachlicher Bildungsperspektive beim fachlich und digital souveränen Aufbau von Kompetenzen (Wissen, Können und Metakognition) in kognitiv aktivierender Form zu unterstützen. Zugleich sollen Lehrkräfte ermutigt und befähigt werden, Lernende mit personalem fachlichem Fokus in subjektiv, emotional und kognitiv-selbstreflexiv aktivierender Form zum Aufbau einer fachlich und digital souveränen selbst- und medienreflexiven Haltung anzuregen (Brüggemann & Frederking, 2024) – auch unter Berücksichtigung ethischer und (gesellschafts-)politischer Facetten fachlicher Bildung. - Das fachdidaktische Modell digitaler Souveränität besitzt dabei in seinen funktionalen Schwerpunkten weitreichende Übereinstimmungen mit den von der OECD (2016; 2021) betonten ‚Skills for a Digital World‘ im Sinne von ‚computer literacy‘ (Tobin, 1983; Poynton, 2005) und ‚digital literacy‘ (Buckingham, 2010; Reddy, Sharma & Chaudhary, 2020), aber auch mit dem ‚European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu, 2017), dem ‚Digital education action plan 2021 – 2027‘ (EU, 2020) und den KMK-Strategiepapieren ‚Bildung in der digitalen Welt‘ (KMK, 2017) und ‚Lehren und Lernen in der digitalen Welt‘ (KMK, 2021). Allerdings stehen fachspezifische Ausprägungen digitaler Souveränität im fachdidaktischen Modell im Fokus. Auch personal ausgerichtete digitale Souveränität besitzt Entsprechungen im internationalen Diskurs, verknüpft diese aber ebenfalls mit fachspezifischen Akzenten. So bestehen weitreichende Übereinstimmungen mit den von der UNESCO formulierten Leitlinien einer ‘citizenship education in the global digital age‘. Wenn diese z.B. als Ziel betonen, „to build learners’ capacities to decode and deconstruct hate speech and mis-, dis-, and mal-information as well as have the ethical foundations, inclusive of empathy, to help not to share it or to create it” (UNESCO, 2022, p. 9; vgl. auch Lambrechts, 2020, 6), so entspricht der erste Teil der Aussage (bis „information“) Prinzipien funktionalen fachlichen Lernens, während personale fachliche Bildungsziele im Schlussteil in den Fokus rücken - in der Betonung von ethischen Prinzipen, von Empathie und der Bereitschaft Hassbotschaften und Mis-, Des- und Falschinformationen weder weiterzuleiten noch zu erzeugen. Über diese Leitlinien hinaus ist aber auch die Verortung subjektiver, emotionaler und kognitiv-selbstreflexiver Bildungserfahrungen im Selbst- und Weltverhältnis der Lernenden Ziel personal ausgerichteter digitaler Souveränität. Hier bestehen Verbindungen zur Tradition des amerikanischen Pragmatismus, so zu George Herbert Meads Grundierung fachlicher Lernprozesse in der Identität der Lernenden – „Everything a child gets must come through a problem of his own - (Mead, 1911, p. 464f.) – und zu John Deweys erfahrungsorientiertem Credo „education of, by, and for experience” (Dewey 1938, p. 29).
Auf Basis der im letzten Kapitel formulierten theoretischen Prinzipien liegt den in den DiSo- und DiäS-Forschungsverbünden entwickelten und evaluierten Fortbildungsmodulen für Lehrkräfte der sprachlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ästhetischen Fächer ein fachdidaktisches Modell digitaler Souveränität zugrunde. In diesem Modell werden drei Zielperspektiven mit funktionalen und personalen Schwerpunkten zu sechs Dimensionen digitaler Souveränität verbunden (vgl. Abb. 1; vgl. Brüggemann & Frederking, 2024, S. 14-24):
- Funktionale und personale digitale Bildungsprozesse von Lernenden fachlich und digital souverän initiieren, moderieren und unterstützen können (D1&D2).
- Funktionale und personale fachliche Bildungsprozesse von Lernenden fachlich und digital souverän initiieren, moderieren und unterstützen können (D3&D4).
- Funktionale und personale fachspezifische digitale Bildungsprozesse von Lernenden fachlich und digital souverän initiieren, moderieren und unterstützen können (D5&D6).
In den Teilprojekten der DiSo- und DiäS-Forschungsverbünden sollen auf dieser Basis fachspezifische Ansätze zur Förderung digitaler Souveränität im Bereich sprachlicher, gesellschaftlicher, ökonomischer und ästhetischer Bildung in funktionaler wie personaler Hinsicht entwickelt, evaluiert, optimiert und disseminiert werden.

Artelt, C. (2023). Digitale Souveränität – Ein Bildungsauftrag! In: Akademie Aktuell Jahrgang Heft 1, Ausgabe Nr. 792023.
Baumert, J. & Kunter, M. (2006). Stichwort: Professionelle Kompetenz von Lehrkräften. (Paralleltitel: Keyword: Professional competencies of teachers.) Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 9(4), 469–520.
Baumert, J. & Kunter, M. (2011). Das Kompetenzmodell von COACTIV. In M. Kunter, J. Baumert, W. Blum, U. Klusmann, S. Krauss & M. Neubrand (Hrsg), Professionelle Kompetenzen von Lehrkräften. Ergebnisse des Forschungsprogramms COACTIV. (S. 29–53). Waxmann.
Bayrhuber, H. (2017). Allgemeine Fachdidaktik im Spannungsfeld von Fachwissenschaft und Fachdidaktik als Modellierungswissenschaft. In H. Bayrhuber, U. Abraham, V. Frederking, W. Jank, M. Rothgangel & H. J. Vollmer, Auf dem Weg zu einer Allgemeinen Fachdidaktik. Allgemeine Fachdidaktik, Band 1, (S. 161–178). (= Fachdidaktische Forschungen, Band 9). Münster/New York: Waxmann.
Bayrhuber, H., & Frederking, V. (2024). Subject didactic knowledge (SDK). A heuristic model based on a theory of functional and personal facets of subject-matter education (SME) and its empirical implications. Journal of Curriculum Studies, 56(3), 246–265. https://doi.org/10.1080/00220272.2024.2318736
Blossfeld, H.-P., Bos, W., Daniel, H.-D., Hannover, B., Köller, O., Lenzen, D., McElvany, N., Roßbach, H.-G., Seidel, T., Tippelt R. & Woßmann, L. (2018). Digitale Souveränität und Bildung. Hrsg. Von Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. Münster/New York: Waxmann.
Brüggemann, J. & Frederking, V. (2024). Ein fachdidaktisches Modell digitaler Souveränität als Basis innovativer Lehrkräftebildung im Bereich sprachlicher, gesellschaftlicher, ökonomischer und ästhetischer Bildung. Online-Quelle: https://digitale-souveränität.online/index/static/pdf/pub_bj_fv_2024.pdf (PDF)
Buckingham, D. (2010). "Defining Digital Literacy". In B. Bachmair (ed.), Medienbildung in neuen Kulturräumen (in German) (S. 59–71). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-92133-4_4.
Dewey, J. (1938) 1997. Experience and Education. New York: Touchstone.
DigCompEdu (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2760/159770.
Ernst, C. (2020). Der Grundsatz digitaler Souveränität.: Eine Untersuchung zur Zulässigkeit des Einbindens privater IT-Dienstleister in die Aufgabenwahrnehmung der öffentlichen Verwaltung (Schriften zum Öffentlichen Recht, Band 1426)
EU (2020). Digital education action plan 2021 – 2027. Resetting education and training for the digital age. Online-Quelle: https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/deap-factsheet-sept2020_en.pdf [Aufruf 12.01.2024].
Frederking, V. (2017). Allgemeine Fachdidaktik – Metatheorie und Metawissenschaft der Fachdidaktiken. Begründungen und Konsequenzen. In H. Bayrhuber, U. Abraham, V. Frederking, W. Jank, M. Rothgangel & H. J. Vollmer (Hrsg.), Auf dem Weg zu einer Allgemeinen Fachdidaktik. Allgemeine Fachdidaktik, Band 1 (S. 179–203). (= Fachdidaktische Forschungen, Band 9). Münster/New York: Waxmann.
Frederking, V. (2022): Digitale Textsouveränität. Funktional-anwendungsorientierte und personal-reflexive Bildungsherausforderungen in der digitalen Weltgesellschaft im 21. Jahrhundert: Eine Theorieskizze [Version 3, Januar 2022]. https://www.deutschdidaktik.phil.fau.de/files/2021/09/digitale-textsouveraenitaet.pdf [20.01.2023].
Frederking, V. & Romeike, R. (Hrsg.) (2022). Fachliche Bildung in der digitalen Welt. Digitalisierung, Big Data und KI im Forschungsfokus von 15 Fachdidaktiken. Allgemeine Fachdidaktik, Band 3. (= Fachdidaktische Forschungen, Band 14). Münster/New York: Waxmann.
Frederking, V. & Bayrhuber, H. (2017). Fachliche Bildung. Auf dem Weg zu einer fachdidaktischen Bildungstheorie. In: Bayrhuber, Horst et al. (Hrsg.): Auf dem Weg zu einer Allgemeinen Fachdidaktik. Allgemeine Fachdidaktik, Band 1 (S. 205-247). Münster: Waxmann
Frederking, V. / Bayrhuber, H. (2020): Fachdidaktisches Wissen und fachliche Bildung. In: Scholl, D., Wernke, S. & Behrens, D. (Hrsg.): Allgemeine Didaktik und Fachdidaktik. Jahrbuch für Allgemeine Didaktik 2019 (S. 10-29). Baltmannsweiler: Schneider.
Friedrichsen, M. & Bisa, P.-J. (Hrsg.) (2016a). Digitale Souveränität. Vertrauen in der Netzwerkgesellschaft. Springer VS: Wiesbaden.
Friedrichsen, M. & Bisa, P.-J. (Hrsg.) (2016b). Analyse der digitalen Souveränität auf fünf Ebenen. In M. Friedrichsen & P.-J. Bisa (Hrsg.), Digitale Souveränität. Vertrauen in der Netzwerkgesellschaft (S. 1–7). Wiesbaden: Springer VS.
GFD – Gesellschaft für Fachdidaktik e.V. (2018). Fachliche Bildung in der digitalen Welt. Online-Quelle: https://www.fachdidaktik.org/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/GFD-Positionspapier-Fachliche-Bildung-in-der-digitalen-Welt-2018-FINAL-HP-Version.pdf [Aufruf 12.07.2024].
Glasze, G., Odzuck, E. & Staples, R. (Hrsg.) (2022). Was heißt digitale Souveränität? Diskurse, Praktiken und Voraussetzungen »individueller« und »staatlicher Souveränität« im digitalen Zeitalter. (= Politik in der digitalen Gesellschaft 3). Bielefeld: transcript-Verlag.
Goldacker, G. (2017). Digitale Souveränität. Kompetenzzentrum Öffentliche IT. Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme. Online-Quelle: https://www.oeffentliche-it.de/documents/10181/14412/Digitale+Souveränität [Aufruf 12.07.2024].
KMK Kultusministerkonferenz (Hrsg.) (2017): Bildung in der digitalen Welt. Strategie der Kultusministerkonferenz. https://www.kmk.org/themen/bildung-in-der-digitalen-welt/strategie-bildung-in-der-digitalen-welt.html [12.07.2024].
KMK Kultusministerkonferenz (Hrsg.) (2021): Lehren und Lernen in der digitalen Welt: Kultusministerkonferenz verabschiedet ergänzende Empfehlung zur Strategie „Bildung in der digitalen Welt“. https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2021/2021_12_09-Lehren-und-Lernen-Digi.pdf [12.07.2024].
Koziol, K., Vogel, N. & Steib, R. (2020). Bildung und Medienkompetenz: Wege zur digitalen Souveränität. München: kopaed.
Lambrechts, W. (2020). Learning ‘for’ and ‘in’ the future: on the role of resilience and empowerment in education. (Background paper for the Futures of Education initiative). Online-Quelle: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374088 [Aufruf 2.07.2024].
Mead, G.H. (1910) 2016. The Philosophy of Education. Edited and introduced by Gert Biesta and Daniel Tröhler. Abingdon, New York: Routledge.
Müller, J. & Kammerl, R. (2022). »Digitale Souveränität«: Zielperspektive einer Bildung in Zeiten tiefgreifender Mediatisierung? In Glasze, G., Odzuck, E. & Staples, R. (Hrsg.), Was heißt digitale Souveränität? Diskurse, Praktiken und Voraussetzungen »individueller« und »staatlicher Souveränität« im digitalen Zeitalter (S. 201–228). (= Politik in der digitalen Gesellschaft 3). Bielefeld: transcript-Verlag.
OECD (2016). “Skills for a Digital World”, Policy Brief on The Future of Work, OECD Publishing, Paris. Online-Quelle https://www.oecd.org/els/emp/Skills-for-a-Digital-World.pdf [Aufruf 12.07.2024].
OECD (2021). „PISA 2025 Learning in the Digital World“. Online-Quelle: https://www.oecd.org/pisa/innovation/learning-digital-world/ [Aufruf 12.07.2024].
Peuker, E. (2020). Verfassungswandel durch Digitalisierung. Digitale Souveränität als verfassungsrechtliches Leitbild. In Jus publicum. Nr. 286. Tübingen: Mohr Siebeck.
Poynton, T. A. (2005). "Computer Literacy across the Lifespan: a Review with Implications for Educators". Computers in Human Behavior. 21 (6) 861–872. https://doi.org/10.1016/j.chb.2004.03.004.
Reddy, P., Sharma, B. & Chaudhary, K. (2020). Digital literacy: A review of literature. International Journal of Technoethics (IJT), 11(2), 65–94.
Rohleder, B. (2019). Digitale Souveränität: Positionsbestimmung und erste Handlungsempfehlungen für Deutschland und Europa. BITKOM, (deutsch). Online-Quelle: https://bitkom.org/sites/default/files/file/import/BITKOM-Position-Digitale-Souveraenitaet.pdf [Aufruf 12.07.2024].
Rothgangel, M. (2020). Allgemeine Fachdidaktik als Theorie der Fachdidaktiken. In Rothgangel, M., Bayrhuber, H., Abraham,U., Frederking, V., Jank, W. & Vollmer, J.H.: Lernen im Fach und über das Fach hinaus. Bestandsaufnahmen und Forschungsperspektiven aus 17 Fachdidaktiken im Vergleich. Allgemeine Fachdidaktik. Band 2 (S. 577-594). Münster: Waxmann.
Tobin, C. D. (1983). "Developing Computer Literacy". The Arithmetic Teacher. 30 (6) 22–23, 60. https://doi.org/10.5951/AT.30.6.0022.
UNESCO (2015). Global citizenship education: Topics and learning objectives. UNESCO. Online-Quelle: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002329/232993e.pdf [2.07.2024].
UNESCO. (2022). Citizenship Education in the Global Digital Age. Thematic paper. Online-Quelle: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381534 [2.06.2023].
Wittpahl, V. (2017). Digitale Souveränität: Bürger, Unternehmen, Staat. Berlin/Heidelberg: Springer Vieweg.
Wolff, M. C. (2022). Digitale Souveränität. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.
Prof. Dr. Volker Frederking hat den Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg inne. Forschungsschwerpunkte bilden u.a. empirische Kompetenz- und Unterrichtsforschung, fachspezifische Mediendidaktik, die Theorie der Allgemeinen Fachdidaktik sowie die Grundlegung einer Theorie fachlicher Bildung und ihre empirische Überprüfung als Basis fachdidaktischer Bildungsforschung.
Prof. Dr. Jörn Brüggemann hat den Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg inne. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der empirischen Kompetenz- und Unterrichtsforschung, der fachdidaktischen Lehrkräfteforschung und der Geschichte des Literaturunterrichts.